TU Wien
Spatial Justice Assessment Wien, WS 12/13
Die gerechte Stadt
Untersuchungsgebiete: Stadlau – das Gebiet um den Verkehrsknoten S-Bahn/A23, Erdberg – rund um die Anlage TownTown und Liesing – der Platz und die Neubebauung des Brauereiareals.
Wie gerecht ist das, was dort geschieht? Wie gerecht ist die Nutzung des öffentlichen Raumes, wie sieht es mit dem Zugang zu selbstbestimmter Gebäudenutzung, mit der Entwicklungsfähigkeit des Quartiers aus? Im Rahmen der Lehrveranstaltung werden Modelle der Gebiete gebaut, die die subjektive Wahrnehmung des Raumes und der Funktionen darstellen, und es werden Maßnahmenvorschläge für einzelne Problempunkte ausgearbeitet. Implizit kommt es bei der Diskussion zum konkreten Ort auch zu einem Hinterfragen der Kriterien der Gerechtigkeit, wie sie in den Standards formuliert sind.
11.10.2012: Auftakt mit Susan S. Fainstein
Gemeinsamer Workshop mit Gabu Heindl und Studierenden der Akademie für Bildende Künste.
Gäste: Susan S. Fainstein und Johannes Novy
31.10.2012: Präsentation
Die drei Gruppen stellen ihre Wahrnehmungen und Analysen vor und verweisen auf individuelle Handlungsansätze.
Gastkritiker Robert Temel stellt aus seiner Perspektive grundsätzliche und gebietsbezogene Fragen.
Die Ergebnisse – die Vorstellung davon, wie man unter den Bedingungen einer offenen, multiethnischen Gesellschaft räumliche Gerechtigkeit schaffen kann, aber auch die Maßnahmenvorschläge in den einzelnen Gebieten – sollen nun vor allem den öffentlichen EntscheidungsträgerInnen vermittelt werden.
Parallel dazu geht die Diskussion weiter: Wie kann man Gerechtigkeit durch städtebauliche Arbeit unterstützen?

Stefan Mayr, Philipp Sulzer, Anthi Kanelli, Evanthia Koutulaki, Zeynab Waezi, Markus Mitrovits
Rafael Kopper, Phillip Feldbacher, Christine Ehrenhöfer, Christine Lechner, Fabian Müller
Linda Ringqvist, Joel Persson, Elisabeth Hofstetter, Lilya Nenkova, Josef Öhreneder
Individuelle Entwürfe – Auswahl
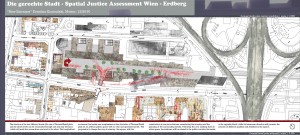

Artikel im GAT: Spatial Jusitice Assessment
WS 08/09: Entwurfsseminar, Standort Aspern
Manuelle Gautrand, französische Architektin hat an der TU im WS 08/09 als Gastprofessorin mit den Studierenden eine Entwurfsaufgabe betreut, die sich mit dem Areal des ehemaligen Flugfelds Aspern befasste.
auf Einladung von a.o.Univ.Prof. DI Dr. Christian Kühn, Inst. für Gebäudelehre, TU Wien
Auszug des Leitfaden für die Bebauung
erstellt für die Entwurfsarbeit mit Gastprofessorin Manuelle Gautrand
Das Projekt:
Der neue Stadtteil am Flugfeld Aspern umfasst 240 ha. Das Gebiet wird sich in mehreren Phasen in einen multifunktionalen Standort verwandeln: Großzügige Grünflächen, ein attraktives Umfeld für Gewerbe und Produktion, Einrichtungen für Soziales, Freizeit und Kultur, eine leistungsfähige Verkehrsanbindung sowie Naherholungsgebiete und auch als Wissenschafts- und Bildungsbezirk wird dem Flugfeld Aspern eine bedeutende Rolle zukommen. Ab 2010 werden sukzessive die Anbindungen an Schnellbahn, die ÖBB-Linie Wien-Bratislava, zwei U-Bahn-Stationen und zwei Autobahnanschlüsse sowie an den Flughafen Wien Schwechat hergestellt. Von Bratislava ist das Flugfeld zukünftig in 28 Bahn-Minuten erreichbar, von der Wiener Innenstadt werden es bloß 22 Minuten sein. Im Endausbau werden 20.000 Menschen am Flugfeld wohnen und etwa 20.000 Menschen arbeiten. Die Entwicklung erstreckt sich voraussichtlich über einen Zeitraum von 20 Jahren.
Allgemeine Zielsetzungen – zentrale Werte:
Urbanes Erleben
Das Gebiet wird zu einem urbanen Stadtraum entwickelt. Menschen mit unterschiedlicher Geschichte mit unterschiedlichen Lebensstilen finden am Flugfeld ihre neue Heimat und Raum zur Entfaltung. Hochwertige städtische Funktionen wie U-Bahn, soziale oder kulturelle Einrichtungen, Dienstleistungen und ein entsprechendes Handelsangebot unterstützen dieses Ziel.
Freier Raum auf vielen Ebenen
Der Freiraum ist klar in zwei Funktionszonen gegliedert: Eine ruhige, private Zone und eine aktive, lebendige und robuste Zone. Die Gebäude richten sich nach diesem Prinzip aus, die Nutzer können sich auf die Einhaltung dieses Prinzips verlassen. Jede Wohnung soll mit einem wohnungsbezogenen Freiraum ausgestattet sein.
Fußgänger/innen im Mittelpunkt
Jeder bauliche Entwurf stellt die Fußgänger und Fußgängerinnen in den Mittelpunkt: Detaillierung, Verbindungen, Geschwindigkeit, Vielfalt, Sicherheitsfragen und Komfort sind primär auf deren Bedürfnisse abgestimmt. Die Planung für den motorisierten Individualverkehr muss sich diesen Gegebenheiten anpassen.
Nutzungsmischung und –vielfalt
Aktivität und öffentliches Leben machen die Stadt interessant. Diese entstehen durch Nutzungsvielfalt auf engem Raum. Wohnen, Arbeiten, Lernen, Einkaufen und Freizeit sind heute nebeneinander möglich. Jedes Projekt soll dazu beitragen.
Kleinteiligkeit
Vielfalt kann nur entstehen, wenn die einzelnen Elemente klein genug sind. Kein Gebäude oder keine Nutzung soll dominieren. Das Prinzip Kleinteiligkeit gilt auch für die Gebäude selbst, besonders in der Sockelzone: Variation und Gliederung schaffen spannende Räume.
Kreativität und Offenheit
Kleinteiligkeit und Vielfalt erfordern zwangsläufig die Beteiligung vieler Akteur/innen. Offenheit gegenüber der Kreativität der und des Einzelnen ist wichtig. Abstimmungsprozesse und Kooperationen werden gefördert. Ein leistungsfähiger kooperativer Planungsprozess und klare Spielregeln treiben die städtebauliche Entwicklung.
Gemeinsames Engagement
Gemeinsam genutzte Einrichtungen und ein attraktiver Grün- und Freiraum sind der Mehrwert für die Nutzer/innen des Stadtteils – das Ganze ist eben mehr als die Summe seiner Teile. Dieses Prinzip erfordert, dass sich alle Investor/innen entsprechend an der Schaffung oder dem Betrieb gemeinsamer Qualitäten beteiligen.
 Gastkorrektur Johannes Fiedler und Claudia Nutz
Gastkorrektur Johannes Fiedler und Claudia Nutz
Internationale Urbanisierung, SS 2005
Institut für Regionalforschung
Johannes Fiedler: Expansion und Dispersion
> 2005_LV Internationale Urbanisierung
archurb · 25.11.2010← zurück zur Übersicht







